Microservices
Definition & Bedeutung
Microservices sind eine moderne Methode zum Aufbau und zur Weiterentwicklung von Software-Anwendungen. Sie zeichnen sich durch eine Struktur aus, bei der einzelne, unabhängige Funktionsbereiche – sogenannte Services – lose gekoppelt zusammenarbeiten. Jeder dieser Services erfüllt eine klar umrissene Aufgabe und tauscht über standardisierte Schnittstellen, meist via REST-API, Daten mit anderen Diensten aus. Für Online-Händler und E-Commerce-Verantwortliche gewinnen Microservices immer mehr an Bedeutung, weil sie neue Flexibilität, Skalierbarkeit und eine höhere Innovationsgeschwindigkeit ermöglichen.
Was sind Microservices?
Microservices sind kleine, eigenständige Softwarebausteine innerhalb einer größeren Anwendung. Jeder Microservice bildet einen in sich abgeschlossenen Geschäftsbereich ab, wie zum Beispiel Produktverwaltung (PIM), Warenwirtschaft, Kundenverwaltung oder die Abwicklung von Bestellungen. Das Ziel: Anwendungen modular und unabhängig voneinander weiterentwickeln, testen und ausliefern zu können. Diese Modularität unterscheidet Microservices maßgeblich von klassischen "Monolithen", bei denen das gesamte System aus einer einzigen, eng verflochtenen Einheit besteht.
- Unabhängigkeit: Jeder Service kann separat entwickelt, bereitgestellt und aktualisiert werden.
- Fokussierung: Microservices sind auf eine konkrete Geschäftsaufgabe zugeschnitten.
- Kommunikation: Die Kommunikation erfolgt über fest definierte, oft sprachunabhängige Schnittstellen (APIs).
Wie funktioniert die Microservices-Architektur?
Architekturstil und Prinzipien
Die Microservice Architektur basiert auf der Grundidee, eine komplexe Anwendung in viele kleine, eigenständige Dienste zu zerlegen. Jeder Service ist in seinem Bereich autark, hat eine eigene Datenhaltung und kann unabhängig von anderen Services skaliert und ausgerollt werden. Typisch ist hier das Prinzip "Do one thing, and do it well" – jeder Service übernimmt genau eine Geschäftsfunktion. Die Microservices kommunizieren über klar definierte APIs und verbergen ihre technischen Details hinter diesen Schnittstellen.
- Isolation: Microservices laufen in eigenen Containern oder Servern und sind so gegenüber Fehlern oder Überlastung anderer Dienste geschützt.
- Unabhängige Verantwortung: Jedes Entwicklerteam ist für einen oder mehrere Microservices verantwortlich, von der Entwicklung bis zum Betrieb.
- Technologiefreiheit: Jeder Service kann mit eigenen Programmiersprachen oder Datenbanken arbeiten, solange die Schnittstelle eingehalten wird.
Wichtige Begriffe rund um Microservices
- Bounded Context: Dieser Begriff beschreibt einen klar definierten Aufgabenbereich innerhalb der Geschäftslogik, der von einem Microservice eigenständig abgedeckt wird – zum Beispiel das Order Management.
- API (Application Programming Interface): Die Kommunikationsschnittstelle, über die Microservices miteinander oder mit externen Systemen interagieren.
- Orchestrierung: Die Steuerung von Abläufen zwischen mehreren Microservices.
- Choreografie: Ein Ansatz, bei dem Microservices über Ereignisse lose und ohne zentrale Steuerung miteinander arbeiten.
Welche Vorteile bieten Microservices im E-Commerce?
Der modulare Ansatz von Microservices bringt für den E-Commerce, speziell für Online-Händler und Start-ups, spürbare Vorteile:
- Schnellere Markteinführung: Neue Shop-Funktionen oder Module wie z.B. Payment oder Custom Billing können unabhängig voneinander entwickelt und zeitnah ausgerollt werden.
- Skalierbarkeit: Lässt der Traffic im Online-Shop zu Peak-Zeiten rasant ansteigen, können gezielt die stark beanspruchten Services (wie Warenkorb oder Checkout-Prozess) skaliert werden, während andere Dienste unverändert bleiben.
- Agilität: Microservices ermöglichen eine flexiblere Weiterentwicklung und regelmäßige, risikoärmere Updates ohne den gesamten Shop offline zu nehmen.
- Fehlertoleranz: Fällt ein einzelner Microservice (z.B. die Rechnungsstellung) aus, bleiben andere Teile des Shops funktionstüchtig, so dass Kunden weiterhin einkaufen können.
- Technologische Innovationsfähigkeit: Einzelne Services können auf den neuesten Technologien aufgebaut werden, ohne das gesamte System umrüsten zu müssen. Für jede Aufgabe kann das beste Tool ausgewählt werden.
Welche Herausforderungen und Nachteile bringen Microservices mit sich?
Auch wenn Microservices viele Chancen bieten, bringt dieser Ansatz spezifische Herausforderungen mit sich, die vor allem bei der Einführung in gewachsene IT-Landschaften beachtet werden sollten:
- Komplexeres Management: Die Vielzahl an voneinander unabhängigen Diensten erhöht den Koordinationsaufwand für Monitoring, Logging und das Deployment.
- Verteilte Datenhaltung: Jeder Service verwaltet seine eigenen Daten, was die konsistente Verwaltung z.B. von Kundendaten erschwert.
- Abhängigkeiten und Versionsmanagement: Es ist nicht immer transparent, welche Service-Version mit welchen anderen Diensten kompatibel ist.
- Netzwerk-Latenzen: Der intensive Datentransfer zwischen Microservices kann neue Latenzen und Fehlerquellen ins Spiel bringen.
- Migration und Change Management: Der Umstieg von einem Monolithen auf Microservices erfordert organisatorische Veränderungen und Schulungen.
Wie unterscheiden sich Microservices von monolithischer Architektur?
Im direkten Vergleich wird deutlich, warum immer mehr Online-Händler auf Microservices umsteigen: Während monolithische Architekturen alle Funktionen in einer einzigen Anwendung bündeln, teilen Microservices die Gesamtanwendung in unabhängige, kleine Einheiten auf.
Vergleich: Monolith – Microservice – Modularer Monolith
- Monolith: Eine komplette Anwendung, alle Module sind fest miteinander verbunden. Änderungen und Skalierung betreffen immer das ganze System. Das heißt, wenn die Anwendung erweitert oder verändert wird, wird die gesamte Architektur komplexer.
- Microservice: Losgelöste Dienste, jedes Team kann unabhängig neue Features entwickeln, testen und deployen, ohne dass eine Unterbrechung der Anwendung als Ganzes notwendig ist. Schnittstellen sind klar definiert.
- Modularer Monolith: Zwischenlösung mit modular aufgebautem Code, aber immer noch als eine einzige Anwendung ausgeliefert. Geringere Flexibilität als bei Microservices.
Wie werden Microservices gestaltet und entwickelt?
Microservice-Design und Best Practices
- Domain-driven Design: Identifiziere wichtige Geschäftsbereiche und mappe diese auf eigenständige Microservices.
- Klein und fokussiert: Services sollen möglichst schlank und spezialisiert sein – je kleiner, desto besser wartbar.
- Teamgröße: Ein Microservice sollte von einem überschaubaren Team (5–7 Personen) in kurzer Zeit – idealerweise binnen eines Monats – neu entwickelt oder aktualisiert werden können.
Orchestrierung und Choreografie
- Orchestrierung: Durch zentrale Steuerung werden Abläufe und Interaktionen zwischen Microservices koordiniert – z.B. beim Bestellprozess.
- Choreografie: Die Microservices reagieren auf Ereignisse und arbeiten lose gekoppelt; etwa wie ein automatischer Versand nach Zahlungseingang ohne zentrale Instanz.
API-Design und Kommunikation
Die Qualität der API ist entscheidend: Sie muss verständlich, dokumentiert und stabil sein, damit andere Services oder externe Partner darauf zugreifen können. Moderne Tools wie Swagger helfen dabei, Schnittstellen selbstdokumentierend zu gestalten.
- APIs setzen meist auf REST, HTTP/HTTPS oder Messaging-Protokolle.
- Schnittstellen sollten klar strukturiert und möglichst wenig von internen Umsetzungen abhängig sein.
Pattern Language
- Circuit Breaker: Verhindert, dass ein Ausfall in einem Service das Gesamtsystem beeinträchtigt.
- API Gateway: Übernimmt die Bündelung und das Routing von Anfragen an die richtigen Microservices.
- Service Discovery: Automatisches Auffinden und Anbinden von Services, wenn sich die Infrastruktur dynamisch ändert.
Welche Technologien und Methoden helfen bei der Implementierung von Microservices?
Technologien und Tools: Java, Docker & Cloud
- Java und weitere Sprachen: Viele E-Commerce-Plattformen setzen auf Java, Go oder Node.js zur Entwicklung einzelner Services.
- Docker: Container-Technologien sorgen für Unabhängigkeit und erleichtern den Betrieb in verschiedenen Umgebungen.
- Cloud-Services: Skalierung und Ausfallsicherheit lassen sich in Cloud-Umgebungen wie AWS, Azure oder Google Cloud leichter realisieren.
Microservices und DevOps
Microservices entfalten ihren Nutzen besonders im Zusammenspiel mit DevOps-Methoden: Automatisierte Tests, Continuous Integration und kontinuierliche Auslieferungen (CI/CD) werden damit zum Standard. So können Shop-Betreiber rasch reagieren, ohne dass ihre Plattform instabil wird.
Datenmanagement und Data Mesh
- Getrennte Datenhaltung: Jeder Microservice pflegt seine eigene Datenbank – das fördert Unabhängigkeit und reduziert Wechselwirkungen.
- Data Mesh: Dieser Ansatz denkt Datenzugriffe als dezentrale Services und macht so skalierbare Datenarchitekturen möglich.
Skalierung und Monitoring
Load Balancer, Kubernetes und Monitoring-Tools wie Prometheus sorgen dafür, dass einzelne Dienste automatisiert skalieren können und jederzeit ein Überblick über Zustand und Auslastung besteht.
Wie können Sicherheit und Management bei Microservices gewährleistet werden?
Herausforderungen: Sicherheit & Breaking Changes
- Autorisierung und Authentifizierung: Zentrale Auth-Systeme wie OAuth oder SSO sind wichtig, damit alle Microservices sichere Identitäten prüfen können.
- Breaking Changes: Anpassungen an Schnittstellen müssen stets rückwärtskompatibel sein oder sauber versioniert werden.
Management und Governance
Ein konsequentes Lifecycle-Management für Microservices umfasst Monitoring, Logging, Performance-Messung und die Kontrolle aller Service-Versionen. Governance-Tools helfen beim Überblick, insbesondere bei mehreren Entwicklerteams oder externen Partnern.
Wie sieht der praktische Einsatz von Microservices im E-Commerce aus?
Typische Einsatzszenarien
- Bestellprozesse: Einzelne Microservices für Warenkorb, Zahlungsabwicklung, Versand und Rechnungsstellung.
- Produktdatenmanagement: PIM-Module als eigene Microservices, um Produktstammdaten flexibel zu erfassen und zu publizieren.
- Kampagnenmanagement: Dynamische Preis- und Rabattlogiken lassen sich in eigenen Services umsetzen.
Reale Beispiele und Unternehmens-Cases
Ein Blick zu großen E-Commerce-Playern wie Netflix zeigt: Hier laufen hunderte Microservices im Verbund, um weltweiten Usern maßgeschneiderte Angebote bereitzustellen. Für mittelständische Online-Händler bedeuten Microservices etwa, dass sie Module wie Order Management, Payment oder Billing einzeln anpassen können – unabhängig vom restlichen System.
Migration von Monolith zu Microservices
Die Transformation erfolgt meist schrittweise, indem Funktionen eines Monolithen sukzessive ausgebaut und in eigene Microservices überführt werden. Erfahrungsgemäß empfiehlt sich, mit stark genutzten Modulen – etwa dem Checkout – zu starten und die Systemlandschaft Schritt für Schritt zu entflechten. Neben technologischen Aspekten ist auch die Organisation betroffen: Kommunikationswege ändern sich, Teams übernehmen mehr Verantwortung für „ihre“ Services.
Hublify & Microservices
Hublify folgt konsequent dem Microservice-Prinzip. Die Module – etwa Order Management, PIM, Warenwirtschaft, CDM und Billing – sind als eigenständige, lose gekoppelte Services umgesetzt. Damit ermöglichen sie Online-Händlern, ihr System flexibel und zukunftssicher weiterzuentwickeln.

Headless Commerce - Muss der Handel kopflos sein?
Alle Welt spricht von „Headless Commerce“, auch wenn es technologisch gesehen keine Innovation ist. Was verbirgt sich hinter dem Wort „headless“? Ist diese Software-Architektur erfolgsversprechender als herkömmliche Shopsysteme?
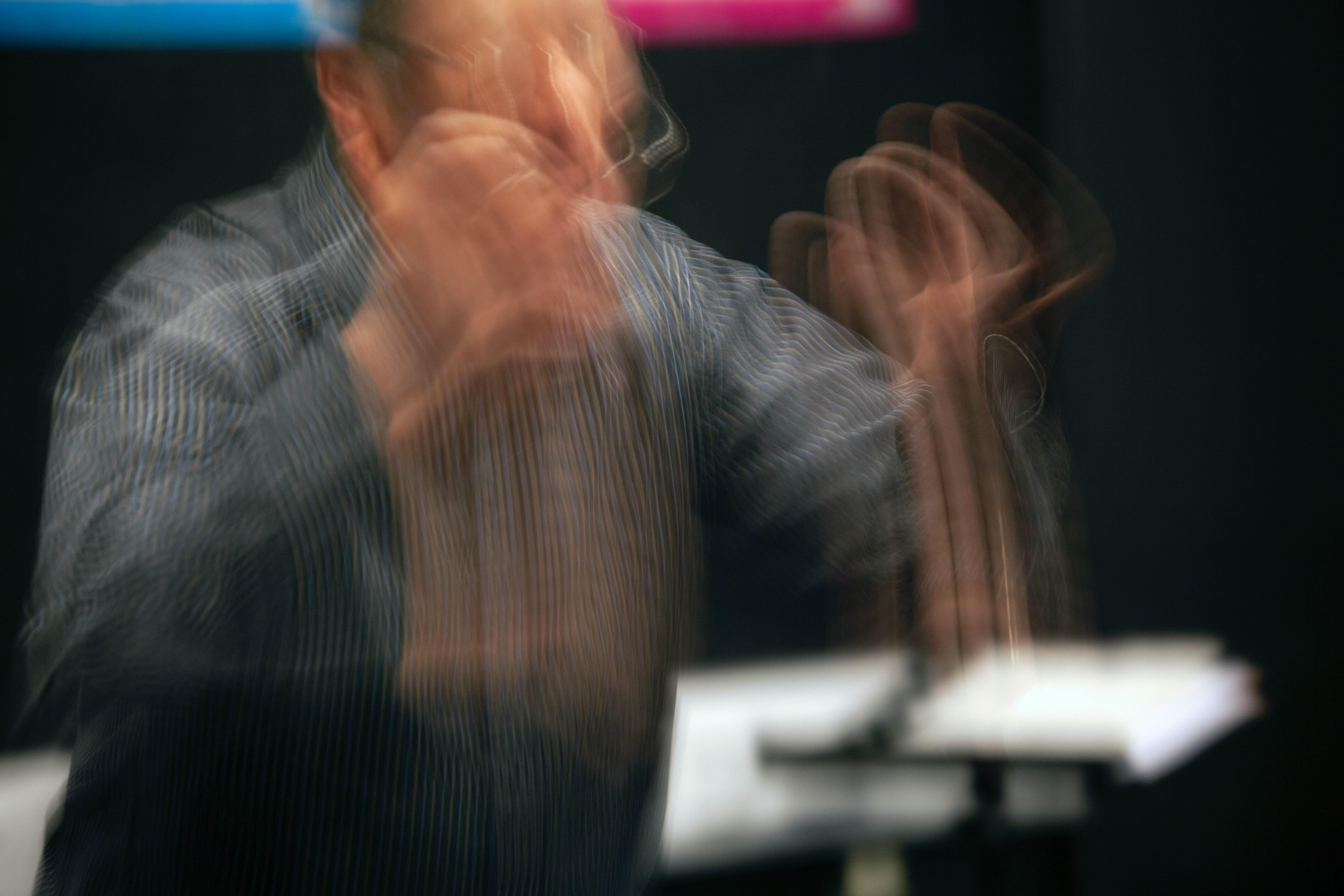
Was ist dran an Composable Commerce? Eine Weiterentwicklung von Headless Commerce?
Warum spricht nun die eCommerce-Welt von 'Composable Commerce'? Gibt es modulare Software-Architekturen nicht schon lange?

Warum PIM die Grundlage für Headless Commerce ist
Headless Commerce ist heutzutage üblich im eCommerce. Wie fängt man am besten an? Mit einem PIM.
Entdecke passende Hublify Apps

Weniger Aufwand und bessere Datenqualität für konsistente Produktinformationen auf allen Kanälen

Effiziente Auftragsabwicklung, Kommissionierung und Logistik

Die Zentrale für alle Kundendaten und Basis für Personalisierung
Verwandte Artikel
API-FirstHeadless Commerce
Composable Commerce

